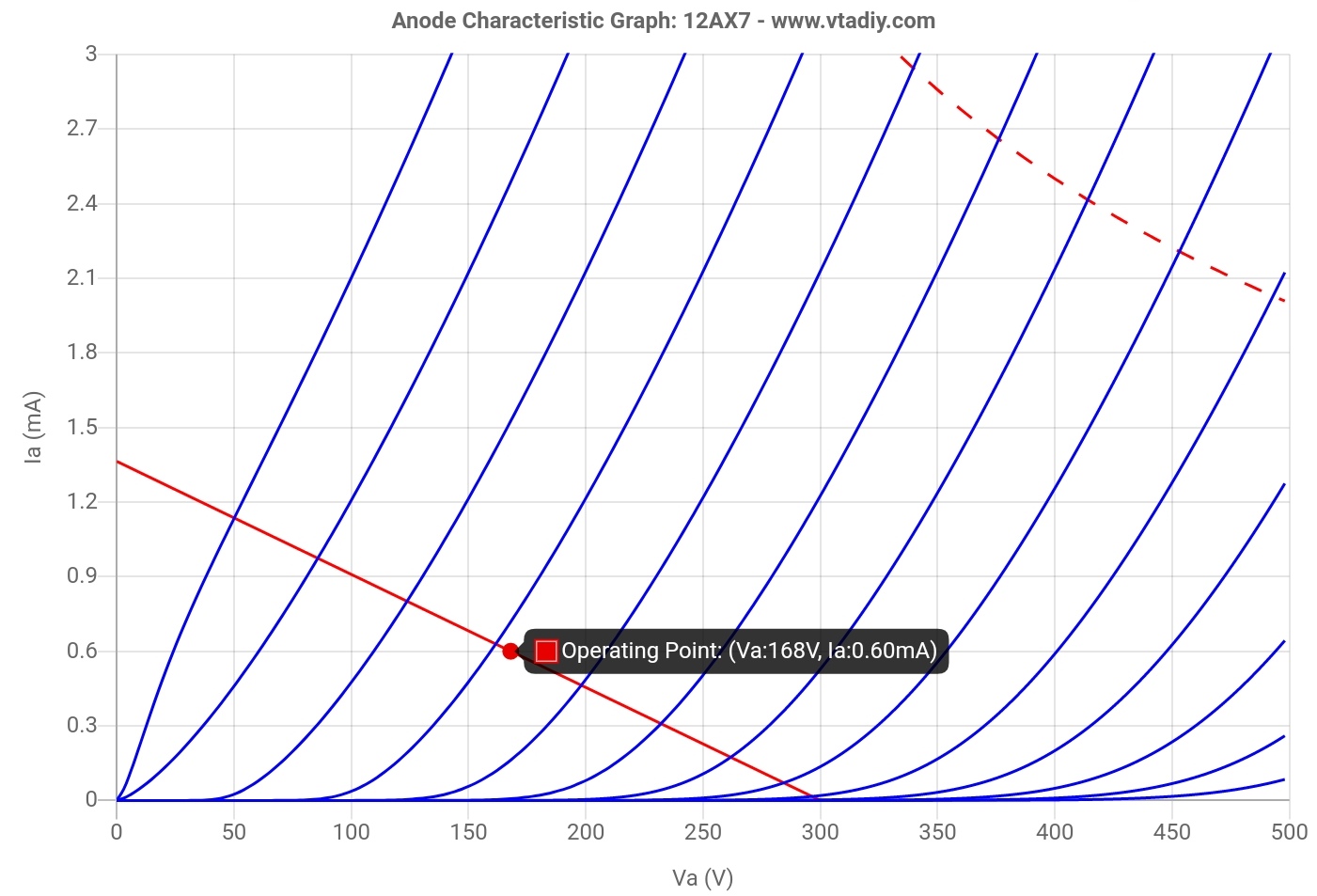Auffällig ist diese kleine Einschnürung in der oberen Halbwelle des PI. Genau dazu hat Blencowe etwas geschrieben, muss ich mal nachlesen.
Nö, das ist ganz normal, und eine Folge des Betriebs mit Gegenkopplung.
Mit angeschlossener Gegenkopplung "versucht" der PI das Sättigungs-Artefakt der Endstufe zu kompensieren. Was er natürlich nicht kann, er versucht er es mit Gegenkopplung dann aber trotzdem.
Gegenkopplung kann manchmal (oder besser oft) ganz schön nervig sein, z.B. wenn wenn man Fehler in einer Endstufe sucht, oder z.B. irgendwo in der Schaltung noch optimieren will usw. usw.
Ein riesengroßer Vorteil der Gegenkopplung ist allerdings der dass sie in der Lage ist einen eigentlich(!) zu kalt eingestellten Bias zu kompensieren.
Je nach Stärke der Gegenkopplung, sie ist irgendwo stark mitbestimmend wie viel Biasspannung die Pentoden minimal benötigen damit es zu keinen Übernahmeverzerrung beim Wechsel in den B-Betrieb kommt.
Je stärker die Gegenkopplung, desto geringer kann die Biasspannung werden, desto geringer kann der Class-A Anteil der Aussteuerung sein, und desto höher die erzielbare Ausgangsleistung der Endstufe.
edit:
du hast oben ja indirekt nach Endstufen ohne Gegenkopplung gefragt. Diese Endstufen haben für gewöhnlich(?) einen ziemlich hohen Class-A-Anteil in der Aussteuerung, und entsprechend dann eher nur geringe erzielbare Ausgangsleistung. Einer der berühmtesten Vertreter dieser Endstufen ist wohl der VOX AC30.
edit meint noch,
die Begrenzung der positiven Halbwelle am Ausgang des Kathodenfolgers dürfte eigentlich so nicht sein.
Die Ansteuerung der Pentoden erfolgt ja über 22k im Signalweg. Wenn die Gitter der Pentoden aufmachen dann fließt zwar etwas Strom, der wird aber über die 22k stark begrenzt, und den muß die ECC81 eigentlich problemlos liefern können.